Gabriel rechnet sich selbst dem
„neuen Realismus“ in der Philosophie zu und es geht ihm nach eigenem
Bekunden darum, in seinem Buch eine neue, realistische Ontologie (Lehre
vom Sein) zu präsentieren. Seine neue Philosophie entwickelt er
voraussetzungsfrei, d. h. sie soll verständlich bleiben, auch wenn man
z. B. vorher noch kein Werk über Erkenntnistheorie gelesen hat. Die Welt
definiert der Autor weder als Gesamtheit der Dinge noch der Tatsachen,
sondern als den Bereich, in dem alle anderen Bereiche vorkommen, als
Bereich aller Bereiche. Die ontologischen Grundeinheiten seines Systems
sind die Sinnfelder. Das sind für ihn die Orte, an denen etwas
erscheint. Der Umstand, dass etwas in einem Sinnfeld erscheint, ist für
ihn die Existenz. Die Welt als „Supergegenstand“, als Bereich aller
Bereiche existiert für Gabriel nicht, weil sie sich durch nichts von
allem anderen unterscheidet und nur mit sich selbst identisch ist. Sie
sticht sozusagen durch nichts mehr hervor. Anstelle der einen Welt tritt
dann bei ihm die Vorstellung von unendlich vielen Welten, die sich zum
Teil überlappen, zum Teil aber völlig unabhängig voneinander sind. Dabei
kann nur existieren, was in einem Sinnfeld vorkommt, außerhalb davon
gibt es keine Gegenstände oder Tatsachen. Gabriel spricht von einer
unendlichen Verschachtelung, die mitten im Nirgendwo, mitten im Nichts
stattfindet. Ein „Außerhalb“ gibt es nicht. Gäbe es die Welt, müsste sie
seiner Meinung nach in einem Sinnfeld erscheinen, was nicht möglich ist.
Könnten wir einen Gegenstand völlig isolieren, so hörte er dieser
Theorie zu folge sofort auf zu existieren, denn er wäre nun von jedem
Sinnfeld isoliert, in dem er aber erscheinen muss, um zu existieren. So
ergibt sich das Bild einer Welt, die sozusagen unendlich häufig in sich
selbst hineinkopiert ist; sie besteht aus unendlich vielen kleinen
Welten, die wiederum aus unendlich vielen kleinen Welten bestehen. So
erkennen wir immer nur Ausschnitte aus dem Unendlichen, während uns der
Blick auf das Ganze verwehrt bleibt, weil es noch nicht einmal
existiert. Gabriel spricht in diesem Zusammenhang von einer
Sinnexplosion mitten im Nichts. Dabei geht der neue Realismus davon aus,
dass wahre Erkenntnis eine Erscheinung der Sache selbst ist. Die Aufgabe
des Forschers, eigentlich die Aufgabe von uns allen, besteht nun nach
Meinung des Autors darin, die Suche nach der (unmöglichen)
allumfassenden Gesamtstruktur aufzugeben und die unendlich vielen
bestehenden Strukturen besser und kreativer, vorurteilsfreier zu
verstehen. So können wir beurteilen, was bestehen bleiben soll und was
verändert werden muss. Wir sind auf einer gigantischen Reise, auf der
wir sozusagen von nirgendwo herkommend ins Unendliche schreiten. In
seinem Buch geht der Autor in separaten Kapiteln auch noch unter anderem
auf den Sinn von Religion und von
Kunst ein.
Das Buch ist recht flott geschrieben
und alles andere als ein unverständlicher, sprachlich verkorkster
Wälzer. Trotzdem ist aber der Inhalt hoch anspruchs – und gehaltsvoll.
So halte ich es denn sowohl als für den Fachphilosophen interessant als
auch für ein populärwissenschaftliches Werk, eine schöne Mischung also,
die man nicht allzu häufig vorfindet. Tatsächlich hat der Autor mein
Interesse an ontologischen Fragestellungen wecken können, allerdings
vertritt er seine Thesen mit so viel Überzeugung und Elan, dass mögliche
Einwände gegen seine Theorie für meinen Geschmack ein bisschen zu knapp
und manchmal auch etwas zu oberflächlich vorkommen. Das hat meinen Blick
manchmal weniger geweitet, als vielmehr verengt. Trotzdem ist es
natürlich aber immer noch ein lesenswertes und auch unterhaltsames Buch.
Jürgen Czogalla,
01.08.2013
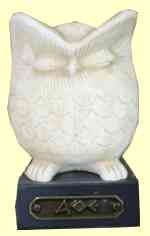

![]()