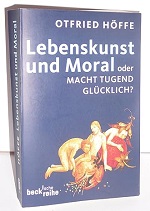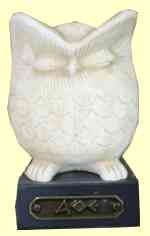
Philosophisch-ethische Rezensionen
(Erscheinungsdatum der rezensierten Bücher: 20. und 21. Jahrhundert)
- Aktuelle Rezension
- Rezensionen nach Autor
- Neueste Rezensionen
- Gästebuch
- Mail an Rezensenten
- Philosophenraten
Otfried Höffe , Lebenskunst und Moral - oder macht Tugend glücklich?, München 2009, 1. überarbeitete Neuausgabe
In seinem Buch stellt Höffe 2 große Grundrichtungen einer möglichen ethischen Theorie dar, nämlich eine Ethik nach dem Prinzip der Eudaimonie mit der Letztbegründung „Glück“ als das zu erstrebende Ziel, die von Aristoteles herrührt, und eine Ethik nach dem Prinzip „Autonomie“, die von Immanuel Kant begründet worden ist. Beide Ethiken sind für Höffe, wenn sie recht verstanden werden, gut begründete, in sich schlüssige Ethiken, auf denen sich ein geglücktes Leben aufbauen lässt. Er beschreibt beide Konzepte ausführlich und stellt sie in den Kontext heutiger Fragen und Problemkreise, in denen sie sich seiner Meinung nach auch nach wie vor bewähren. Allerdings wird deutlich, dass er die Ethik mit dem Prinzip „Autonomie“ als höherwertig bewertet: Und zwar weil er der Meinung ist, dass in der autonomen Moral die Moralität um ihrer selbst willen gewollt wird, sozusagen aus einer moralischen Selbstachtung heraus, bei der eudaimonistischen Moral dagegen wird moralisch „nur“ gehandelt um das Gute zu erreichen, nicht einfach nur weil es gut ist; das sei weniger hoch zu bewerten. Denn für die Moralität spreche letztlich nicht die bloße Erfüllung eines Glücksverlangens, sondern dass man mit sich selbst moralisch im reinen sei. (In diesem Zusammenhang unterscheidet Höffe 3 Stufen der Freiheit innerhalb der praktischen Vernunft).Trotzdem ist er aber der Überzeugung, dass sich beide Wege nicht ausschließen, sondern dass es Überschneidungen gibt. Auch eine Ethik die sich am Glück orientiert kommt nämlich zum Beispiel nicht ohne gehöriges Interesse auch am Wohlergehen des Anderen aus, denn wer sich die Sympathie seiner Mitmenschen verscherzt wird wohl kaum glücklich werden können. Der Unterschied zwischen den beiden Moralen liegt aber nach Höffe darin, dass die autonome Moral verlangt auch dann noch moralisch zu handeln, wo es tatsächlich dem Eigeninteresse zuwiderläuft. Aber auch eine autonome Moral, so Höffe, kann erkennen, dass es nichts besseres als ein glückliches Leben geben kann, wenn nur klar ist, dass es nur dann wirklich gut sein kann, wenn es der moralischen Bedeutung von gut (Moralität um ihrer selbst willen erstreben) entspricht. Dann würde sich der Gegensatz von Moral und Lebenskunst
aufheben.
Ich habe mich durch das anspruchsvolle Buch etwas durchkämpfen müssen, wurde dafür dann aber letztlich durch interessante Einsichten belohnt. Warum der Autor der Meinung ist, dass Ethik einer Letztbegründung unbedingt bedarf, ist mir allerdings nicht ganz klar geworden. Dazu hätte ich gerne etwas mehr erfahren.
Jürgen Czogalla, 26.09.2009