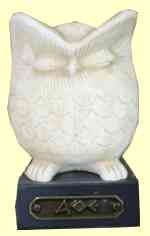
Philosophisch-ethische Rezensionen
(Erscheinungsdatum der rezensierten Bücher: 20. und 21. Jahrhundert)
- Aktuelle Rezension
- Rezensionen nach Autor
- Neueste Rezensionen
- Gästebuch
- Mail an Rezensenten
- Philosophenraten
Michela Marzano, Philosophie des Körpers, München 2013
In ihrem mit 144 Seiten schon
ein bisschen schmalen Bändchem konstatiert die Autorin in der Einleitung,
dass die Philosophen doch meistens die Vernunft, den menschlichen Verstand
oder vielleicht auch noch einmal menschliche Leidenschaften zum Thema haben.
Die Realität, der Sinn und der Wert der Körperlichkeit, die Endlichkeit der
menschlichen Existenz werden darob vernachlässigt. Wenn er, der Körper, –
zumeist am Rande – thematisiert wird erscheint er allzu oft als Gefängnis,
als Maschine oder als Materie, wird reduziert auf das Bild der Last, von der
man sich befreien kann oder auf seine Funktion als komplexer Organismus. Im
Grunde unternimmt es die Autorin in ihrem Buch nach dem Sinn der leiblichen
Existenz zu fragen, wobei sie ihn in seiner materiellen Existenz beleuchtet,
als auch in seiner kulturellen und sozialen Dimension. Der Körper erscheint
bei ihr als Objekt, das aber auf eine bestimmte Präsenz verweist, anders als
die anderen materiellen Objekte um uns herum. Er führt mitten in das Sein
der Person. Durch den Körper ist der Mensch als inkarniertes Wesen an die
Materialität der Welt gebunden, woraus sich eine zweifache Weise unserer
Körpererfahrung, so die Autorin, ergibt, wir haben nämlich zu ihm sowohl
eine instrumentelle als auch eine konstitutive Beziehung. Dieser nach
Meinung der Autorin widersprüchlichen Existenz nähert sie sich in ihrem Buch
von historisch-philosophischer Seite, versucht aber auch insgesamt den
Widersprüchen der körperlichen Existenz, die jedem Menschen innewohnen,
tiefergehend nachzuspüren. Das Buch hat fünf große Abschnitte: „Der
Dualismus und seine Etappe“, „Vom Monismus zur Phänomenologie“, „Der Körper
zwischen Natur und Kultur“, „ Verwerfung und Verdinglichung: die dunklen
Seiten der Materie“ und „Sexualität und Subjektivität: der Vollzug des
Fleisches“. Zu dem Ganzen gibt es dann noch eine Einleitung und ein
Schlusswort. Die großen Abschnitte sind dann nochmals in kleinere,
nummerierte, überschriebene Einheiten unterteilt, die sehr gedrängt, aber
dabei nicht oberflächlich die Gedankengänge der Autorin vorantreiben und
ordnen. Ob sie nun die Vorstellung des Körper als Gefängnis der Seele
darstellt, Körperlosigkeit des Cyberspace, die Fallstricke des
Konstruktivismus,
die
Erfahrung von Krankheit, Sexualität oder die perverse
Verdinglichung des Körpers analysiert, die Gedanken der Autorin werden in
klarer, eingängiger und gut nachvollziehbarer Sprache präsentiert. So sehe
ich das Buch auch nicht unbedingt als eine Lektüre für die abgelegene
Gelehrtenstube, sondern man kann sich damit durchaus auch einmal die Zeit am
Strand vertreiben. Und man bekommt eine Menge schöner, inspirierender und wichtiger Gedanken
mit auf den Weg. Es ist aber kein Buch, das die Gedanken in ein ganz festes
Korsett einzwängen will, sondern es bleibt alles ein bisschen luftig und
frei schwebend. Das Buch hat mich gut unterhalten und genährt
zurückgelassen, ohne dass es mir sonderlich auf den Magen geschlagen ist
(will sagen: Ich empfinde es nicht als besonders theorielastig).
Jürgen Czogalla, 26.06.2013
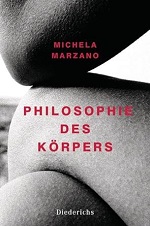
![]()