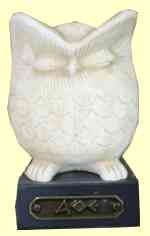
Philosophisch-ethische Rezensionen
(Erscheinungsdatum der rezensierten Bücher: 20. und 21. Jahrhundert)
- Aktuelle Rezension
- Rezensionen nach Autor
- Neueste Rezensionen
- Gästebuch
- Mail an Rezensenten
- Philosophenraten
Michael Pauen, Ohne Ich kein Wir: Warum wir Egoisten brauchen, Berlin 2012
Mein Eindruck vom Buch ist zwiespältig: Zum einen blendet der Autor altruistisches Handeln aus seinen Betrachtungen aus – er will ja den emphatischen Egoismus befördern und hält so im Grunde altruistisches Verhalten nur noch in Notfällen für vernünftig. Aber zum Glück, wie ich meine, ist unser Leben noch überall von altruistischen Handlungen umgeben, die in der Tat viel zu unserem Wohlbefinden beitragen: Meiner Mutter schenke ich eben nicht aus Eigeninteresse einen Blumenstrauß zum Muttertag, genauso wenig wie ich meiner vollbepackten Nachbarin die Tür aufhalte, weil ich dabei an meinen eigenen Gewinn denke. Und wenn mein Freund sich mit mir unterhält erwarte ich zu recht, dass er im Umgang mit mir nicht bloß sein Eigeninteresse verfolgt. Wahrscheinlich ist es doch so, dass gerade weil wir paradoxerweise unser Eigeninteresse auch immer mal wieder bereit sind auszublenden und zurückzustellen, wir letztlich auch Gewinne - und zwar keine kleinen - für uns und unser Umfeld einfahren können: Gewinne, die nicht berechnet sind. Zum anderen möchte der Autor auch moralische Fragestellungen völlig ausblenden und rein pragmatisch argumentieren. Das führt dann unter anderem dazu, dass ihm eine wirkliche Versöhnung von individuellem Interesse und Gruppeninteresse in meinen Augen kaum gelingt, denn hier entfaltet Moral und moralisches Umfeld gerade ihre besondere, ja überragende Kraft. So bleibt dem Autor auch nicht viel mehr dazu zu sagen, als dass eben Diskussionen und Verabredungen helfen und gegebenenfalls Strafen gegen Trittbrettfahrer vorzunehmen seien – das empfinde ich als extrem unterkomplex.
Jürgen Czogalla, 01.05.2012

![]()