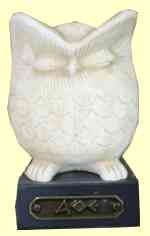
Philosophisch-ethische Rezensionen
(Erscheinungsdatum der rezensierten Bücher: 20. und 21. Jahrhundert)
- Aktuelle Rezension
- Rezensionen nach Autor
- Neueste Rezensionen
- Gästebuch
- Mail an Rezensenten
- Philosophenraten
Herbert Schnädelbach, Was Philosophen wissen und was man von ihnen lernen kann, München 2012
Herbert Schnädelbach konstatiert in der Einleitung seines Buches eine Skepsis gegenüber der Philosophie als Wissenschaft, die er unter anderem auf ein gravierendes Vorurteil zurückführt, dass zurückgeht auf den Anspruch den erstmals René Descartes an die Philosophie stellte und der bis weit ins 20. Jahrhundert große Verbreitung fand: Die Meinung nämlich, nur was man zweifelsfrei und vollständig begründen könnte, dürfe man auch als wirkliches philosophisches Wissen bezeichnen. Schnädelbach findet, dass dieser Wissensanspruch völlig überzogen ist und leicht dazu führen kann die Philosophen in die Resignation zu treiben. Denn Wissen sei nun einmal fehlbar – und das werde ja auch in anderen Einzelwissenschaften so akzeptiert. Fehler können wir, darauf weist der Autor hin, auch in der Philosophie immer wieder nachweisen und aus ihnen lernen. Auch hier gibt es einen Wissensfortschritt. Der Autor unternimmt es nun den Wissensbestand der heutigen Philosophie in 14 Kapiteln kurz umreißend darzustellen, in denen er sich mit jeweils einem zentralen philosophischen Thema näher beschäftigt (Philosophie und Wissenschaft, Wissen, Sinn und Bedeutung, Das Urteil, Denken und Sprechen, Das Ich und ich, Subjekt-Objekt, Selbstbewusstsein, Gesetze, Naturalistischer Fehlschluss, Werte und Normen, Handlung, Vernunft, Analytisch–synthethisch). Das führt der Autor dann in der Regel so durch, dass er kurz den philosophiegeschichtlichen Entwicklungsgang des Themas darstellt und bei dem heutigen Wissenstand zuletzt anlangt, wobei dieser nicht unbedingt einhellig zu sein braucht, wie sich erweist, aber doch ein Erkenntnisfortschritt deutlich wird. (Als besonders bedeutend würdigt er immer wieder die Beiträge der analytischen Sprachphilosophie seit dem 20. Jahrhundert). Damit versucht der Autor sein Fach auch ein bisschen aus dem für die Öffentlichkeit kaum mehr zu verstehenden verwissenschaftlichten Spezialistentum herauszuführen, wieder mehr in eine Rolle, die die Philosophie einst in Europa hatte, nämlich als breitenkulturwirksame Tätigkeit. Das gelingt dem Autor meiner Meinung nach nicht ganz: Denn tatsächlich nimmt er sich für die Erörterung seiner zentralen philosophischen Themen jeweils nur ein paar Seitchen Zeit; das macht es für den philosophischen Einsteiger schon etwas schwierig, seinem gedrängten Gedankengang zu folgen. Wer sich dagegen schon etwas mit Philosophie beschäftigt hat, wird aber merken und mit Gewinn für sich mitnehmen, wie die Ausführungen des Autoren doch bei aller Kürze in die Tiefe gehen – nur denke ich, wird auch dieser Leser sich bisweilen – wie auch ich - etwas mehr Ausführlichkeit wünschen. Das Buch endet leider nach dem 14. Kapitel abrupt, es wird nicht versucht, ein Fazit oder einer Zusammenschau der Kapitel in einem Schlusskapitel zu ziehen und so wird das Buch für mich denn doch wieder das Abbild der derzeitigen Fragmentierungen des Fachs der Philosophie im Kleinen. Trotzdem ist das Buch natürlich immer noch gut.
Schnädelbach gehört leider zu den philosophischen Autoren, die keinen Wert darauf legen alle ihre englischsprachigen Zitate auch ins Deutsche zu übersetzen.
Jürgen Czogalla, 03.04.2012
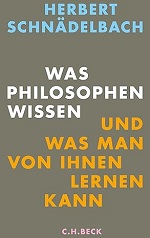
![]()