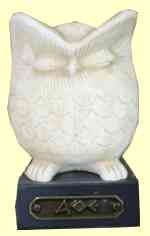
Philosophisch-ethische Rezensionen
(Erscheinungsdatum der rezensierten Bücher: 20. und 21. Jahrhundert)
- Aktuelle Rezension
- Rezensionen nach Autor
- Neueste Rezensionen
- Gästebuch
- Mail an Rezensenten
- Philosophenraten
Amartya Sen: Die Idee der Gerechtigkeit, München 2010
Sens Buch über die Gerechtigkeit ist über weite Strecken eine Auseinandersetzung mit John Rawls klassischer Theorie der Gerechtigkeit, die, wie auch Sen anmerkt, die einflussreichste Theorie auf diesem Gebiet in heutiger Zeit ist. Sen kritisiert nun dieses viel gerühmte Rawlsche Programm, so dass sich bei ihm eine Art von grundlegender Richtungsänderung ergibt, wenn er auch einem Ideal der Fairness verpflichtet bleibt, wie wir es auch bei Rawls finden. Was möchte denn nun Sen anders machen? Zunächst einmal kritisiert er bei den gängigen Vertragstheorien Rawlscher Prägung, dass sie einen Idealzustand konstruieren und die gegenwärtigen Verhältnisse dann an diesen Idealzustand angleichen wollen. Sen hält dieses Verfahren im Grunde für impraktikabel, er befürwortet ein Verfahren, bei dem auf die Eigenart der fraglichen Gesellschaft Rücksicht genommen wird, auf ihre tatsächlichen Verhaltensmuster. Seiner Meinung nach bedarf es Einigungen über die Rangfolge von Alternativen durch den Prozess eines öffentlichen Vernunftgebrauches. Diesen Ansatz bezeichnet er als komparativ, den von ihm kritisierten Rawlschen als transzendentalen Ansatz. Soziale Verwirklichung der Gerechtigkeit soll Sen zufolge nicht abgelesen werden etwa am Nutzen oder Glück oder der bloßen Verfügbarkeit von bestimmten Gütern, sondern an den Befähigungen und Chancen der Menschen einer Gemeinschaft. Dadurch möchte er auch die Sphäre der Verantwortlichkeit in den Blick holen und Raum für Pflichtgebote schaffen. Die Betrachtung tatsächlicher Befähigungen und sozialer Verwirklichungen von Befähigungen werden so zu ganz zentralen Punkten seiner Gerechtigkeitskonzeption. Außerdem braucht es seiner Meinung nach immer wieder der Perspektive eines "unparteiischen Zuschauers" (er bezieht sich in diesem Zusammenhang auf Adam Smith) um dem Provinzialismus eingekapselter, gruppenisolierter Einstellungen zu entgehen. Er empfiehlt Meinungen jenseits der eigenen kontraktionalistischen Gemeinschaft einzuholen, um auch deren Interessen wahrnehmen zu können und den eigenen Blick zu weiten. Da für Sens Theorie der öffentliche Vernunftgebrauch von zentraler Bedeutung ist, kann es nicht verwundern, dass er ein ganzes Kapitel seines Buches, nämlich das abschließende, der Demokratie widmet, die er als "Regierung durch Diskussion" begreift. Durch den freien Austausch von Informationen sind hier die besten Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Menschen aller Klassen gemeinsam an Bedingungen arbeiten, die für alle gerechter sind, auch wenn wir vollkommen gerechte Zustände nicht erreichen können. Im Kapitel über Demokratie geht der Autor außerdem noch in gesonderten Abschnitten auf die Bedeutung von Menschenrechten ein.
Ein gelungenes Buch.
Jürgen Czogalla, 13.12.2010
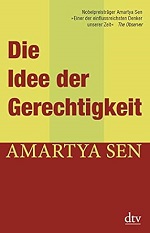
![]()