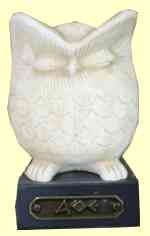
Philosophisch-ethische Rezensionen
(Erscheinungsdatum der rezensierten Bücher: 20. und 21. Jahrhundert)
Michael Hampe über Sprache und Denken
Hampe ist der Meinung, dass Philosophen dazu neigen, konkretes Sprechen und Denken zu etwas Intelligiblem zu verallgemeinern, bei Kant etwa zur allgemeinen Vernunft, bei Heidegger
zu einem Haus des Seins, bei Habermas zu einem universalen Diskurs oder bei Brandom zu einem semantischen Spiel mit intelligiblem Schiedsrichter. Es gebe aber, so Hampe, in Wahrheit nur das
Sprechen von konkreten Sprachgemeinschaften und konkreten Sprechern, die auf die der sie entstammenden Sprachgemeinschaft reagierten (er weist hier explizit auf Forschungsergebnisse von Arne
Næss hin). Bildlich ausgedrückt erscheint Hampe die richtige Sicht der Sprache wie eine zerklüftete, semantische Landschaft, in die sich Menschen mit unterschiedlicher Lebenserfahrungen und
abweichenden Begriffsverwendungen bewegen. Die Lebenserfahrung ist für ihn nur ausnahmsweise durch in einer Theorie organisierten Begriffen bestimmt und zumeist eben auch nicht durch abwägende
Diskurse geleitet. Auch ginge es hier nicht nur um bloße Weitergabe von Informationen oder einem Bedürfnis nach Verständigung. Der Mensch ist zunächst einmal nicht Wissenschaftler, sondern er
spricht primär und zumeist zu anderen, um seine Lebenserfahrung auszudrücken, um diese dann anderen aufzuprägen. Zwar hat der Mensch Sehnsucht nach Sicherheit in einer gewachsenen Lebensform,
aber Langweile und Ermüdung würden auch immer wieder zu Abweichung, Dissens und Erneuerung führen. Dabei hält der Autor die Theorien von einer Ganzheitlichkeit des Sprechens und Lebens und von
Erfahrung und Theorie für eine Illusion.
15.05.2014