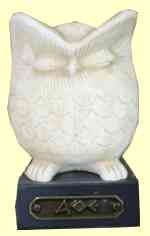
Philosophisch-ethische Rezensionen
(Erscheinungsdatum der rezensierten Bücher: 20. und 21. Jahrhundert)
- Aktuelle Rezension
- Rezensionen nach Autor
- Neueste Rezensionen
- Gästebuch
- Mail an Rezensenten
- Philosophenraten
Ulla Wessels, Das Gute, Frankfurt am Main 2011
Die Autorin erläutert und verteidigt eine Ethik, der es um die Wohlfahrt der Menschen geht und diese Wohlfahrt setzt sich für sie aus hedonischem Glück (das Glück der Freude, der Lust im Gegensatz zum Unglück des Schmerzes und der Unlust) und der Erfüllung von Wünschen zusammen. Damit ein Wunsch auch als „echter“ Wunsch durchgehen kann, muss er nach Meinung der Autorin bestimmte Kriterien erfüllen: Intrinsizität, Angebundenheit an Vorstellungen, Angebundenheit an Empfindungen und Implizitheit. Dabei vertritt sie einen psychologischen Hedonismus, der besagt, dass alle Individuen letztlich nur Wünsche hedonischen Inhalts haben und dass, wenn die Wünsche nichthedonisch wären, sie bloß dazu instrumentell verwendet werden würden um doch wieder letztlich einen hedonischen Inhalt zu erreichen. Betont wird außerdem, dass die Wohlfahrt allein etwas genuin Subjektives wäre. Das Hauptaugenmerk dieser Ethik ruht für mich befremdlicherweise nicht auf der Argumentation für wahre und falsche Handlungen, sondern sie ist wertneutral. Gemessen und beurteilt wird nur die Hedonie und die erreichte Wunschstärke (wenn nur die Wünsche den angegebenen Kriterien entsprechen). Ich meine aber Wünsche stehen im Wechselspiel zu vernünftigen Argumenten und werden durch Argumentation geweckt, verstärkt und geschwächt, bzw. regen Argumentationen an. Ich hätte daher eher erwartet Regeln zu finden, wann eine Argumentation ethisch auf Wahres oder Falsches verweist, als Regeln für den korrekten Wunsch zu bekommen. Denn ob ein Wunsch nun ethisch korrekt ist muss man meiner Meinung nach argumentativ verständlich machen können. Es ist darum meiner Meinung nach auch nicht etwa egal durch welche Argumente ich zu Wünschen komme, ich möchte auch nicht von bloßen (Dumm-)Schwätzern und Werbe- und Propagandafachleuten umgeben sein, sondern von Menschen, die mir die Wahrheit sagen. (Für diesen Wunsch lassen sich eine ganze Fülle von vernünftigen Argumenten nennen, die sich zu überlegen ich an dieser Stelle aber dem geneigten Leser überlassen möchte, denn eine eigene Abhandlung möchte ich hier nicht schreiben). So bleibt der Autorin im Grunde dann auch nichts weiter übrig, als die Wunschstärke der Wünsche, die ihrer Definition entsprechen, gegeneinander abzuwägen, bzw. zu summieren und dann als ethische Entscheidungsgrundlage heranzuziehen (eine hübsche Ethik für Umfrageexperten, Statistiker und Supercomputer, schöne neue Welt), eine wenig überzeugende Methode, wie ich meine, eigentlich ein Armutszeugnis.
Allerdings versteht es die Autorin ihre Thesen und Forschungsergebnisse gut lesbar und verständlich vorzutragen, das Buch hat mich dazu angespornt, eigene Standpunkte zu hinterfragen und mein eigenes Verständnis zu vertiefen. Ein interessantes Buch. Klare Leseempfehlung für alle die, die sich kompakt und verständlich über Glück-Wunsch-Ethiken informieren möchten.
Jürgen Czogalla, 09.01.2012
![]()