Der Autor sucht die Frage nach dem Rätsel unserer Normalität zu beantworten.
Rätselhaft ist es für ihn, dass die meisten einfach so zufrieden sind in einem Alltagsleben, dass seiner Meinung nach
auf der Entrechtung und körperlichen Ausbeutung von Menschen als Human Resources und der planmäßigen Zerstörung des
Ökosystems beruht. Er spricht von einem heutigen, individuellen Konformismus und sucht nach dem Prinzip unserer seiner
Meinung nach perversen Normalität und deren Ursprung. Er meint wir erlernen das Handwerk ein Selbst zu sein nicht, weil
wir nicht mehr die Frage nach dem wirklich Wertvollen stellen und uns nur noch von dem Zeitgeist hin und her treiben
lassen. Dagegen stellt der Autor seine Philosophie, in der es darum geht bewusst daran zu arbeiten, der Mensch zu werden,
den wir für uns und andere sein wollen. Es geht um ein gelingendes, selbstbestimmtes Leben. Dagegen steht der durch
gesellschaftliche Disziplinierung, die Menschen um ihr eigenes Nachdenken bringt, der Konformist und der Funktionär die
sich nur noch geordnet nach Zwecken verhalten, die andere vorgeben und die sie nicht mehr hinterfragen. Er empfiehlt
die bewusste Suspendierung des sozialen Rollen- und Machtgefüges und die Arbeit an einer gemeinsamen Identität, dem
Selbst der Gesellschaft. Er kritisiert den für ihn gängigen Ehrbegriff, den er als zentrale Struktur der modernen Gesellschaft
bezeichnet. Er spricht von einem Spiel um Ansehen und Status und eine Anpassung an vermutete Sachverhalte. Er meint um
seine persönliche Identität zu bilden und aufrechtzuerhalten muss man ständig mit dem anonymen Konsens der Willensäußerungen
der anderen in Tuchfühlung bleiben, das sei die grundlegende sittliche Realität der Neuzeit. Ein so gesellschaftlich
erfolgreicher Mensch steht in Gefahr, diesem Betrieb zumal und insbesondere auch im Arbeitsverhältnis moralisch zu unterliegen
und zum Funktionär zu verkommen. Für ihn kanalisiert die Industriegesellschaft unser Identitätssuche für ihre Zwecke
mit ihrem Angebot aus institutioneller Geborgenheit und der Droge des Erfolges, mit der quasi religiösen Hingabe zum
Betrieb erzeugt wird. Der Autor meint nun, wenn einen dies ganz in seinen Bann schlägt führt eine solche Kariere zu moralischer
Leere, völligem Mangel an menschlichen Beziehungen, Kälte im Umgang, sinnlos-übermäßigem Konsum. Die betriebliche Rationalität
und Professionalität verdrängt bei den Mitarbeitern nach Meinung des Autors Überlegungen was dem Menschen im Allgemeinen
dienen würde, ein auf das Ganze der Wirklichkeit ausgehendes Denken. Stattdessen wird eine Pseudomoral von Erfolg und
die Pseudovernunft der Professionalität angeboten. Die gesamte kulturelle Situation ist nach Meinung des Autors dazu
angelegt unser moralisches Eigenleben auszulöschen. Aus dieser Sicht wird für den Autor auch der Ehrgeiz zum pseudomoralischen
Wahnsinn, einer freiwilligen Umwandlung seiner selbst zu einem Funktionär und der damit verbundenen moralischen Selbstaufgabe.
Er empfiehlt das je eigene öffentlich-politische Engagement, für das, was einem wirklich wichtig ist und das man liebt
einzustehen und der Kreation entsprechender eigener Lebensräume, in denen das mitmenschliche Miteinander im Zentrum steht.
Der Autor arbeitet mit starkem schwarz-weiß Kontrast, der in sich schlechten modernen Kultur und den entmoralisierenden
Arbeitsleben sollen wir durch eigenes, selbstbesinnendes Denken und Widerspruch widerstehen. Meiner eigenen Lebenserfahrungen
entspricht das nicht, vielleicht lebt der Autor einfach auch ein bisschen in anderen Sphären, versucht aber seine Ansichten
als allgemeingültig zu verkaufen. Weder sehe ich unsere Kultur und unsere industrielle Arbeitsgesellschaft als durch und durch
schlecht an, noch einen gewissen Ehrgeiz, Achten auf sein Ansehen, Streben nach Erfolg. Wir haben heute meiner Meinung nach bei
uns mehr Möglichkeiten zum Selbstdenken und zum Engagieren als frühere Generationen, wenn man denn will. Gerade das betriebliche
Leben schildert der Autor in schwärzesten Farben ohne irgendwelche Hilfen anzubieten, wie es vielleicht besser werden kann, im
Grunde ist für ihn das ganze System einfach schlecht. Auch wenn er das so nicht direkt sagt, bleibt da eigentlich nur noch der
Sturz dieses Systems als Möglichkeit, bzw. die Arbeit daran. Ein zorniges Buch, nicht auf Mitgestaltung aus, sondern auf reine
Oppositionsstellung. Eindimensional.
Jürgen Czogalla, 28.06.2020
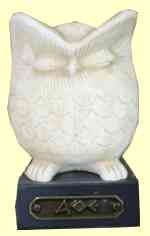

![]()