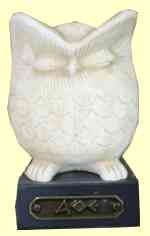
Philosophisch-ethische Rezensionen
(Erscheinungsdatum der rezensierten Bücher: 20. und 21. Jahrhundert)
- Aktuelle Rezension
- Rezensionen nach Autor
- Neueste Rezensionen
- Gästebuch
- Mail an Rezensenten
- Philosophenraten
Adrian Daub, Was das Valley denken nennt. Über die Ideologie der Techbranche, Berlin 2020
Das Buch untersucht die Ideengeschichte des Silicon Valley. Es stellt
heraus worauf Techunternehmer und die sie vergötternden Medien den Blick richten, wenn sie ein Narrativ für ihre
Geschichte suchen, das in die Geschichte der Welt eingefügt werden muss, auch um gegebenenfalls die eigenen Geschäftsmodelle
zu rechtfertigen. Daub stellt die Frage, woher diese Ideale des Valley kommen. Wie denkt der Techsektor über seine
Tätigkeit, wenn er über sein Alltagsgeschäft hinausdenkt, wenn er darüber nachdenkt die Welt zu verändern und woher
kommen diese Ideen? Der Autor arbeitet heraus, dass diese Konzepte nur vorgeblich neuartig sind, sondern vielmehr
sehr alte Motive in neuer Verkleidung darstellen. Sie entspringen in vielem alten amerikanischen Traditionen. Ideen,
die nach Meinung des Autors an sich nicht gefährlich sind, die aber wahrscheinlich zu schlechtem und gefährlichen
Denken führen können. Dabei geht es auch um zentrale Figuren wie Zuckerberg, Jobs, Musk und Thiel. Viele ihrer
Denkmuster entstanden etwa zur gleichen Zeit und waren neuartig, als sie in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts
häufig im Bereich einer Art von Gegenkultur ihre endgültige Form annahmen. Dabei erweist sich diese Geschichte als
provinziell, denn der Techsektor des Silicon Valley rekrutiert seine Mitarbeiter häufig aus den Leuten, mit denen
man zusammen auf der Uni war oder mal zusammengewohnt hat. Die Ideen, denen der Autor nachgeht sind universitätsnah
und universitätsartig und werden am besten erworben indem man das Studium vorzeitig abbricht, wie zum Beispiel auch
im Falle von Mark Zuckerberg. In ihren Narrativen wird das Abschweifen vom üblichen Weg, so der Autor, zur Symptomatik
des Genies erhoben. Der Autor entlarvt den darauf beruhenden Mythos und schlägt vor, den Studienabbruch eher als eine
Art von Auslandssemester zu verstehen. Die Studienabbrecher kehren zwar der Uni den Rücken, um dann allerdings eine Welt
zu errichten, die immer mehr Ähnlichkeit mit der verlassenen akademischen hat. Man bleibt viel längere Zeit kindlich
auf eine Art, die an das Studentenleben erinnert. Studienabbruch als eine Geste der Ablehnung, die genau an dem festhält,
was man abzulehnen vorgibt. An dem Mythos des Studienabbruchs erweist sich die Ideologie des Valleys letztlich
als Selbsttäuschung und Schaumschlägerei. Ganz Ähnliches findet dann der Autor für den Mythos, dass die Plattform
alles ist, dass das Medium die Botschaft ist, ein Gedanke, der auf McLuhan zurückgeht. Dann die Idee, dass man sich
gegen traditionelle Autoritätsstrukturen auflehnen muss, die jeglichen Nutzen eingebüßt haben, das Auflehnen des
Genies, des schöpferischen Menschen gegen die bösen Parasiten, Gedanken die man bei Ayn Rand findet, die sich in
Gesten des Rückzugs und der Melancholie und dem Gefühl von Verfolgung verlieren und die dann dazu führen, dass man
sich in reizbaren Gesten erschöpft die um Ähnlichkeiten mit Ideen bemüht sind. Desweiteren der Gedanke der Verheiligung der
Vernetzung und umspannender Kommunikation, der ausblendet, dass zugleich die Gefahr von Missbrauch und Falschmeldungen
in den sozialen Medien steigt und übersieht, dass gerade unsere Kommunikationssysteme häufig zu den Dingen gehören
über die wir nicht wirklich gut kommunizieren können. Schließlich die Vorstellung, dass alles Begehren ein Spiegelbild
des Begehrens eines anderen Menschen nach dem selben Objekt ist, was René Girard vertreten hat. Wir wollen hier
angeblich das, was andere wollen, was zu Auseinandersetzungen, zu Wettbewerben und Konflikten führt, wobei man dann
die entstandene Gewalt auf ein unschuldiges Opferlamm lenkt (ein Gedanke, den Theologen bisweilen interessant finden).
Menschen als eine Art Lemminge, die herdengleich reagieren, ein Verhalten, dass man manipulieren kann. Im Grunde eine
schwülstige Neubeschreibung hergebrachter Lehre. Schließlich beschäftigt sich der Autor auch noch mit dem Mythos der
Disruption und des Scheiterns ("Scheitere besser!").
Im Grunde Schaumschlägerei und der Versuch Gründe für ihren enormen Erfolg zu finden, was zu einer vollkommen verzerrten
Vorstellung der Wirklichkeit führen kann, was vielleicht aber auch so sein muss, meint der Autor, angesichts der eigenen
Unbegreiflichkeit ihres außerordentlichen Glücks.
Ein schmales Buch, das auch literarisch ein ziemlicher Leckerbissen ist und genüsslich die Mythen des Silicon Valley destruiert, bzw. auf ihre rechte Größe zurecht stutzt. Ein amüsantes Leservergnügen, das aber letztlich die Erfolgsgeschichte des Valley auch nicht wirklich zu erklären versucht, als vielmehr die Jämmerlichkeit ihre Ideen vor Augen führen will. Aber der Erfolg ist nun einmal da. Wäre es da nicht an der Zeit überzeugendere, ehrlichere und realitätsnähere Narrative zu entwickeln? Klare Leseempfehlung!

![]()