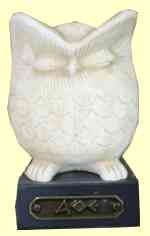
Philosophisch-ethische Rezensionen
(Erscheinungsdatum der rezensierten Bücher: 20. und 21. Jahrhundert)
- Aktuelle Rezension
- Rezensionen nach Autor
- Neueste Rezensionen
- Gästebuch
- Mail an Rezensenten
- Philosophenraten
Anne Dufourmantelle, Lob des Risikos. Ein Plädoyer für das Ungewisse, Berlin 2018
Wer kristallklare, in sich stimmige Verständlichkeit und labyrinthfreie, geradlinige Zielgerichtetheit von einem philosophischen Text erwartet ist bei Dufourmantelle an der falschen Adresse. Das liegt zum einen daran, dass das Buch meiner Meinung nach vor allem auch literarisch ambitioniert ist – bildreiche, phantasieanregende, aber auch immer wieder dunkle Sprache, die das Phänomen des Risikos mehr umkreist, wie ein dunkles, kaum zu benennendes schwarzes Loch, als dass es wirklich tacheles redet, den Kern benennt. Zum Anderen natürlich, dass sie psychotherapeutisch gewonnene Erkenntnisse – manch einer wird sich hier schon schütteln und von Pseudowissenschaft sprechen – mit vermittelt, die sie in der Praxis im Patientengespräch auch immer wieder anwendet und wie es scheint dies auch nicht ganz ohne Erfolg. Philosophie und Psychoanalyse legen hier sozusagen eine spannungsvolle, durchaus faszinierende Hochzeit hin, vieles davon aber für mich überspannt und nicht recht nachvollziehbar, oder würden sie etwa der Autorin zustimmen, dass Traum und Lachen erotische Auflösungen des neurotischen Konflikts sind?
Die Autorin selbst fand 2017 den Tod, als sie zwei Kinder vorm Ertrinken retten wollte.
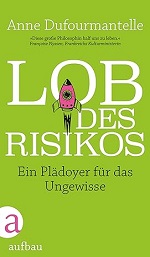
![]()