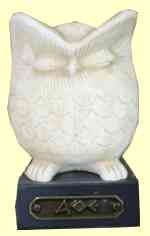
Philosophisch-ethische Rezensionen
(Erscheinungsdatum der rezensierten Bücher: 20. und 21. Jahrhundert)
- Aktuelle Rezension
- Rezensionen nach Autor
- Neueste Rezensionen
- Gästebuch
- Mail an Rezensenten
- Philosophenraten
Stephan Ernst, Grundfragen theologischer Ethik: Eine Einführung, München 2009
Mit seinem Buch wendet sich der katholische Autor, wie er selbst anmerkt, insbesondere an Studierende, Lehrer, Hauptamtliche in der Pastoral, sowie allgemein an theologischer Ethik Interessierter. Das Buch versteht sich als ein Grundriß der theologischen Ethik, das der Vertiefung bedarf. Eine wesentliche These des Autors ist es, dass das, was gut ist, aus der Vernunft erkannt werden kann auch ohne auf christlichen Glauben zu rekurrieren. Christliche, bzw. spezifisch christlich katholische Quellen, wie z.B. Bibel und das katholische Lehramt bringen also in der bloßen Erkenntnis des Guten kein Plus gegenüber der Vernunft und bilden so keine „Sonderehtik“ aus. Wie die Vernunft nun zwischen gut und schlecht unterscheiden kann, ist Thema des ersten Teils des Buches. Nachdem der Autor zunächst einige Möglichkeiten einer Grundlegung der Ethik erläutert und kritisch beleuchtet hat (Ausrichtung an den Willen Gottes, die heilige Schrift, das Gewissen, das natürliche Sittengesetz, die autonome Vernunft) stellt er sein eigenes Modell vor, dass sich an der katholischen Tradition orientiert (immer wieder wird insbesondere das katholische Lehramt zu Rate gezogen oder der hl. Thomas von Aquin), dabei aber bemüht ist Problemkreise der Moderne hinreichend zu berücksichtigen. Der Autor vertritt eine Werteethik, die auf metaphysische Rückgriffe verzichten will. Wichtig und unverzichtbar für eine christliche Ethik ist für den Autor, dass es objektive Werte wirklich gibt. Diese Werte und Güter sollten wir, so der Autor, bei unseren Entscheidungen miteinander abwägen. Ein Gut ist für ihn (wieder bezieht er sich vor allem auch auf den hl. Thomas) etwas, das erstrebt wird, das reine Übel oder Schlechte wird nicht erstrebt; wenn ein Übel erstrebt wird, dann nur um eines in ihm irgendwie enthaltenen Gutes willen. Weil die Wirklichkeit relativ ist, können wir allerdings auch nicht das reine Gute erstreben, sondern müssen bei unserem Handeln auch immer Übles in Kauf nehmen, bzw. wir müssen mögliches Gut dabei ausklammern. Beim Handeln sei nun darauf zu achten, dass das Gute das Üble überwiegt, bzw. das Gute die mitverursachten Übel rechtfertigt. Dabei soll die Verhältnismäßigkeit der Mittel gewahrt bleiben um das Gute zu erreichen, als auch die gewählten Maßnahmen zur Zielerreichung effizient sein um das Gute optimal zu befördern. Die Handlung darf nicht kontraproduktiv zum Handlungsgrund sein. Diese Nicht-Kontraproduktivität sollte auf Dauer und im Ganzen gewollt sein, wobei letzteres bedeutet, dass das zu erstrebende Gut universalisierbar sein sollte. Auf eine metaphysische Wertehierarchie meint der Autor nicht zurückgreifen zu müssen, vielmehr meint er könne man bei Wertekonflikten ein Fundierungsverhalten ausmachen, das auf Erfahrungen beruhen würde und eine mögliche Präferenz hinreichend rechtfertigen könnte. Dabei gilt: Das fundierende Gut darf nicht durch ein durch es bedingendes
Gut behindert oder zerstört werden (Arbeit wäre so etwa die Voraussetzung Geld zu verdienen). Wenn mehrere gleichwertig fundierende Werte zur Disposition stehen würden, sei es notwendig Kompromisse zu schließen. Die zweite grundlegende These des Autor ist es, dass wenngleich das Christliche keine Vorteile bei der bloßen Erkenntnis des Guten gegenüber der Vernunft bieten würde, es doch Vorteile bringen würde bei der Motivation, dass durch die Vernunft erkannte Gute dann auch zu tun, auch wenn das eventuell persönliche Nachteile mit sich bringen würde. Das beruhe vor allem darauf, dass sich der Christ in all seiner Endlichkeit von Gott unbedingt angenommen und geborgen weiß und durch Christus die Befreiung von seiner Schuld erfahre. Das ist dann Thema des zweiten Teiles seines Buches. Mich hat der ethische Ansatz des Autors nicht so recht überzeugen können, vielleicht hätte es dazu umfangreichere Darlegungen seines „Systems“ bedurft. Fundierende Werte – sie werden wohl oft ganz unterschiedlich aussehen, jeweils nach der Perspektive die der Wertende einnehmen wird. Auch die Interessen und Wünsche des Wertenden werden zwangsläufig einfließen (wenn vielleicht auch unbewusst) und
können nicht einfach eliminiert werden. Ehrlicher wäre es darum meiner Meinung nach auch den Interessen und Wünschen der Menschen einen Ehrenplatz in der Ethik einzuräumen, und zwar ganz ausdrücklich. Auch der 2. Teil hat mich nicht recht überzeugen können, denn er setzt eigentlich voraus, dass wenn man nur wirklich ein guter, spiritueller Christ ist, dann auch besser handeln können müsste als der Nicht-Christ (wenn doch nicht, dann hat man das wirkliche Christsein sich eben noch nicht ganz einverleibt). Ich glaube das nicht wirklich auch wenn ich selbst überzeugter Christ bin. Überzeugte Atheisten verfügen auch über gute Motivationsressourcen für das Gute, dann wohl zwar über nichts Unbedingtes, aber das ist doch, Hand aufs Herz, auch gar nicht so recht erfahrbar in unserer relativen Welt. Worin liegt dann aber das Plus des Christseins? Für mich eher im sich Wohlfühlen im Glauben und anderen mit seinem Leben aus dem Glauben ein bisserl Freude zu bereiten, wobei letzteres
aber nicht eine deckungsgleiche Sphäre mit dem ethischen Handeln bildet, auch wenn es Überschneidungen gibt. Trotzdem habe ich das Buch des Autors gerne
gelesen und bin dankbar für die erhaltenen Einblicke in den derzeitigen Stand theologischer Ethik und in seinen vorgeschlagenen Entwurf.
Jürgen Czogalla, 16.03.2010
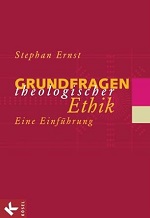
![]()