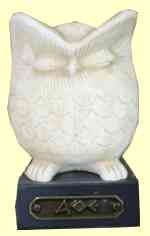
Philosophisch-ethische Rezensionen
(Erscheinungsdatum der rezensierten Bücher: 20. und 21. Jahrhundert)
- Aktuelle Rezension
- Rezensionen nach Autor
- Neueste Rezensionen
- Gästebuch
- Mail an Rezensenten
- Philosophenraten
Alasdair MacIntyre, Der Verlust der Tugend, Frankfurt/NewYork 1995
Meiner Meinung nach ist das Buch teils von grandioser Einseitigkeit, teils ist es meines Erachtens sogar einfach grandioser Unfug. Alles Scheiße mit der Aufklärung und kein gutes Stück, dass sie uns hinterlässt? Das Heil liegt darin ihre Denkwege zu vergessen und zurück zu einem etwas modifzierten Aristoteles zu gehen? Wobei das vorgebliche Scheitern der Aufklärung in extenso nachgewiesen wird, aber viel zu wenig nachgesehen wird, worin denn damals die Menschen eigentlich ein so tiefes Unbehagen am Aristotelismus empfanden und um dann, um nicht ganz zu ersticken, nach anderen, neuen, individuelleren Wegen suchten. Weil diese Untersuchung im Buch meiner Meinung nach so unterrepräsentiert ist, habe ich ein gewisses Unbehagen an all dem aristotelischen Tugendpreis des Buches, denn bei aller Gelehrsamkeit fehlt so der ganzen Behandlung des Themas die wirklich entscheidende Tiefe. Das ist darum etwas schade, weil ich nämlich selbst in der Tat der Meinung bin, dass uns heutigen Aristoteles noch einiges zu sagen hat und dass Tugenden zu entwickeln und sich um ein gutes Leben in seiner Gesamtheit zu bemühen, das Ganze noch eingebettet in eine unterstützende Gemeinschaft, eigentlich eine sehr feine Sache ist. Um das zu sehen, ist es aber wohl kaum nötig, die Denkwege und Erkenntnisse der Aufklärung komplett der Müllhalde zuzuordnen. Interessant fand ich übrigens noch, als bekennender Bewunderer ihrer Werke, dass MacIntyre Jane Austen als die letzte große Vertreterin aristotelischer Tugendethik sieht, bevor unser vorgeblicher moralischer Niedergang so richtig einsetzt.
Das Buch hat mir wichtige Blickwinkel auf die aristotelische Ethik eröffnet, ich fand es aufregend und empfehle es gerne weiter, denn es hat mich gut unterhalten, auch trotz es sich eigentlich in Sprache und Stil eher an ein rein akademisches Publikum wendet und ein wirklich wissenschaftliches Werk sein will.Jürgen Czogalla, 04.04.2013
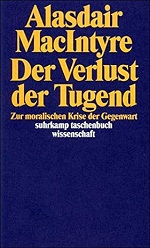
![]()