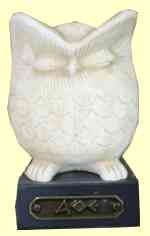
Philosophisch-ethische Rezensionen
(Erscheinungsdatum der rezensierten Bücher: 20. und 21. Jahrhundert)
- Aktuelle Rezension
- Rezensionen nach Autor
- Neueste Rezensionen
- Gästebuch
- Mail an Rezensenten
- Philosophenraten
Michael J. Sandel, Was man für Geld nicht kaufen kann: Die moralischen Grenzen des Marktes, Berlin 2012
Sandel stellt in seinem Buch eine ganze Reihe von Praktiken dar, in denen der Markt traditionelle Werte und Normen zu untergraben beginnt und bei deren Schildern wohl tatsächlich dem Durchschnittsleser nicht so ganz wohl ist: Sei es, dass Wohlhabende mancherorts das Schlangestehen durch Sonderzahlungen überspringen können oder Leute dafür bezahlen, dass sie sich für sie in die Schlange stellen, dass Geldanreize bisweilen in Bereiche eindringen, wo bisher ehrenamtliches, unentgeltliches Engagement für die Gemeinschaft herrschte, dass etwa drogenabhängigen Frauen von einer Organisation Geld angeboten wird, damit sie sich sterilisieren lassen und so keine drogenabhängige Kinder mehr in die Welt setzen, oder dass Lebensversicherungen an Dritte im großen Stil weitergehandelt werden, die so auf den möglichst frühzeitigen Tod derjenigen wetten, deren Police sie erstanden haben. Und natürlich die Werbung, mit der Kinder zum Teil schon in Schulen behelligt werden. Letztlich möchte der Autor durch seine teils drastischen Beispiele zu der Einsicht bringen: Nein, ich wünsche es nicht in einer Gemeinschaft zu leben, in der alles käuflich ist, und es gibt Werte, die man für Geld nicht kaufen können sollte. Er bringt aber nicht nur seine drastischen gesellschaftlichen Beobachtungen einfach nur so vor, sondern versucht auch tatsächlich philosophisch-rationale Begründungen dafür zu finden, warum unser zunächst vielleicht nur unbestimmtes Gefühl, dass hier etwas nicht richtig ist, nicht grundlos ist. Zum Einen ist es das Argument der Fairness, dass Sandel immer wieder vorbringt (es ist zum Beispiel für ihn unfair, wenn reiche Leute Jobsuchende anheuern und sie dafür bezahlen für sie für ein begehrtes kostenloses Gut Schlange zu stehen, und so Ärmeren, die auch bereit sind, selbst Schlange zu stehen, die Plätze zu nehmen) und zum Zweiten das Argument der Korrumpierung (wenn ein an sich kostenloses öffentliches Gut zur Handelsware wird, dann wird es nach Ansicht des Autors in seinem Wert herabgewürdigt, so etwa wenn Hochschulzulassungen käuflich werden oder ein Schwarzmarkt für Plätze in einem Theaterstück entsteht, welches ursprünglich als eine kostenlose Veranstaltung für alle interessierten Bürger gedacht war, auch für die ärmeren). Dabei drischt der Autor aber nicht nur auf den Markt ein, sondern stellt auch immer wieder die Wichtigkeit des Marktes für unser Wohlbefinden heraus und er weiß um die Dilemmata, die sich aus einem Umsichgreifen der Ökonomie ergeben können: Das dadurch eben oft mehr Geld verfügbar wird, um auch öffentliche Einrichtungen, z. B. durch Werbung, besser finanzieren und erhalten zu können, aber immer wieder mit dem Menetekel der Unfairness und Korrumpierung einhergehend. Der Autor hat seine Entscheidung getroffen: Wenn Wertminderung droht oder Menschen erpressbar gemacht werden, wenn also starke moralische Bedenklichkeiten offensichtlich sind, dann sollten wir uns gegen den Markt entscheiden. Das tun wir am besten, wenn wir für unsere Werte in der Öffentlichkeit auch einstehen und auch selbst nicht in der bloßen Sprache des Geldes verbleiben.
Das Buch ist besonders gut lesbar, ja mit den verschiedenen, höchst interessant geschilderten gesellschaftlichen Einblicken, ein sehr unterhaltsames Werk, für das man eigentlich meiner Meinung nach keinerlei philosophische Vorkenntnisse voraussetzen muss.
Jürgen Czogalla, 01.01.2013
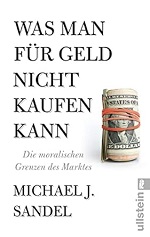
![]()