Für Sandel ist klar, dass Trump gewählt wurde, weil es ihm gelang eine
Quelle von Ängsten, Frustrationen und legitimen Klagen anzuzapfen für die die anderen Parteien keine Antwort hatten.
Ähnliche Probleme, so analysiert er, gibt es in den europäischen Ländern ebenso. Es gilt aus den populistischen
Protesten zu lernen und die eigene Mission neu zu überdenken. Beginnen sollte man laut Sandel damit, dass man einsieht,
dass die Klagen nicht allein wirtschaftlicher, sondern vor allem auch moralisch-kultureller Natur sind. Es geht nicht
bloß um Löhne und Arbeitsplätze, sondern um gesellschaftliche Wertschätzung. Sandel sieht in den Unruhen eine Antwort
auf ein politisches Versagen historischen Ausmaßes. Zwei verfehlte Ansätze schaffen nach Sandel die Bedingungen, die
den Populismus in Gang halten, nämlich einmal das technokratische Konzept, das meint, dass man zentrale moralische
Erörterungen aus der öffentlichen Debatte heraushalten kann und ideologisch strittige Fragen so behandelt, als seien
sie Fragen der wirtschaftlichen Effizienz und damit Aufgabe von Experten mit der Folge einer Einengung der
demokratischen Auseinandersetzung und einer Aushöhlung der öffentlichen Debatte, was ein zunehmendes Gefühl der
Machtlosigkeit erzeugt. Wobei das technokratische, marktfreundliche Konzept der Globalisierung sowohl von den linken
als auch den rechten etablierten Parteien übernommen und akzeptiert wurde und die Profite dieser Politik überwiegend
zu den Spitzen flossen und zu einer vertieften Ungleichheit und wachsenden Macht des Geldes führte. Das zweite Konzept,
dass es zu überdenken gilt ist die
vorherrschende Einstellung gegenüber Erfolg und Scheitern, die nach Sandel dazu führt,
dass die Gewinner auf Nicht-(sonderlich)Erfolgreiche „Loser“ mit Verachtung herabschauen. Diese Phrasen von Aufstieg
und Erfolg finden sich in der Parole, dass diejenigen, die hart arbeiten und sich an die Regeln halten soweit aufsteigen
können, wir ihre Fähigkeiten und Talente sie tragen. Diese einstmals erfolgreichen Phrasen klingen inzwischen aber hohl,
waren aber zum Beispiel noch Regierungsprinzipien der Ära Obama mit der Sandel hart ins Gericht geht und die letztlich
seiner Meinung nach dem Sieg von Trump den Weg bereitete, vor allem, da die demokratische Kandidatin Hillary Clinton
im Wahlkampf immer noch auf diese Phrasen setzte. Die Statistiken sprechen nach Sandel aber eine klare Sprache: Aus
Armut aufzusteigen ist in Kanada, Deutschland, Dänemark und anderen europäischen Ländern heute einfacher als in den USA.
Die Fähigkeit, aus Armut aufzusteigen hängt nämlich weniger vom Ansporn der Armut ab als vom Zugang zu Bildung,
Gesundheitsfürsorge und anderen Ressourcen, die den Menschen helfen am Arbeitsmarkt zu bestehen. Die Meritokratie der
Leistungsgesellschaft hat sich nach Sandel inzwischen in den USA zu einer Erbaristokratie verhärtet. Der amerikanische
Glaube mit harter Arbeit und Talent könne jeder aufsteigen, stimmt mit den Tatsachen nicht mehr überein. Das Problem
wird aber nicht einfach dadurch etwa gelöst die Chancengleichheit zu perfektionieren. Denn moralisch gesehen ist es
zuhöchst fragwürdig, warum die Talentierten die überdimensionierten Belohnungen einer marktgetriebenen Gesellschaft
überhaupt verdienen. Und ist es tatsächlich unser Werk, wenn wir bestimmte Talente besitzen? Der Glaube, jeder erhält
in einer Leistungsgesellschaft genau das, was er auch verdient, sich erarbeitet hat, sorgt bei den Gewinnern für
Überheblichkeit und bei den Verlierern für Demütigung und Unmut, und gerade diese moralische Empfindung macht für
Sandel den Kern des populistischen Aufstandes gegen die Eliten aus. Selbst eine vollkommen faire Meritokratie würde
sich immer noch zersetzend auf die Art und Weise auswirken, in der wir unseren Erfolg deuten. Zugleich ist die
selbstgefällige Ansicht der Spitzen, dass sie ihr Schicksal verdient haben und dass diejenigen die unten sind dies
ebenso verdient haben der moralische Begleiter technokratischer Politik. So wird jeder Sinn für Gabe oder Gnade
verbannt und die Fähigkeit sich selbst als Teil einer Schicksalsgemeinschaft zu sehen unterminiert. Solidarität
schwindet und es entsteht eine Tyrannei von Leistung und Verdienst. Nach Sandel stärken wir unsere Demokratie, wenn
wir zu einem moralisch stabileren öffentlichen Diskurs finden der sich gegen die zersetzenden Auswirkungen des
meritokratischen Wetteiferns auf die sozialen Bindungen stemmt, die unser gemeinschaftliches Leben ausmachen. Eine
Alternative dazu ist für Sandel eine breite Gleichheit, die es auch all jenen, die es nicht zu großem Reichtum oder
einer besonders angesehenen Stellung bringen ermöglicht ein anständiges, würdiges Leben zu führen, in dem sie ihre
Fähigkeiten entfalten und ausüben können und in der sie soziale Wertschätzung erfahren. So wendet er sich gegen eine
konsumorientierte Konzeption des Gemeinwohls, der es nur darum geht, das Wohlergehen der Verbraucher zu maximieren und
in der Demokratie zu nichts weiter als einer Wirtschaft mit anderen Mitteln verkommt und das Schicksal der Bürger nicht
mehr von moralischen Bindungen abhängt, sondern von Einzelinteressen und Vorlieben. Sandel hält für sein Konzept
vollkommene Gleichheit nicht für notwendig, wohl aber, dass sich Bürger unterschiedlicher Lebensbereiche in gemeinsamen
Räumen an öffentlichen Orten treffen können und sich nicht gegenseitig abschotten. Und ein wiedererwecktes Gefühl für
die Zufälligkeiten des Lebens kann zu einer gesunden Demut des „Das hätte auch mir passieren können“ führen als Anfang
eines Weges der aus der brutalen Ethik des Erfolges herausführt, der Gemeinschaft zersetzt.
Auch wenn der Hauptfokus der Ausführungen von Sandel auf den USA liegt – besonders hierzu führt er immer wieder anschauliches
empirisches Material für den Leser bereit, was seine Ansichten stützt – wir Europäer sollten nicht so tun, als würden diese
Tendenzen bei uns in eine völlig andere Richtung gehen, wenn bei uns die Zustände vielleicht auch noch nicht ganz so extrem
sind wie in den USA. Und auch bei uns gibt es ja in den letzten Jahren eine Erstarkung des Populismus. Sandel gibt wichtige
Hinweise für die Entstehung und spricht offen von einem Totalversagen etablierter Parteien. Was er vorschlägt ist eine
anspruchsvolle moralische Wende, aber auch eine Wiedererweckung der Demokratie und Gemeinschaft. Ein wichtiges Buch von
hoher Aktualität mit großem Potential. Nicht gefallen hat mir allerdings, dass in meiner Kindle E-Book Version schon nach
70% des Gesamtumfanges die Anhänge beginnen. Das halte ich nicht mehr für verhältnismäßig.
Jürgen Czogalla, 12.12.2020
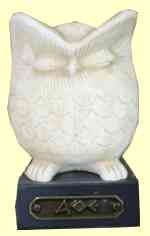
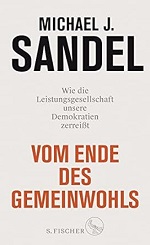
![]()