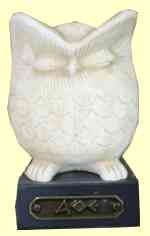
Philosophisch-ethische Rezensionen
(Erscheinungsdatum der rezensierten Bücher: 20. und 21. Jahrhundert)
- Aktuelle Rezension
- Rezensionen nach Autor
- Neueste Rezensionen
- Gästebuch
- Mail an Rezensenten
- Philosophenraten
John R. Searle, Wie wir die soziale Welt machen, Berlin 2012
In seinem Buch geht der Autor, ein bedeutender US-amerikanischer zeitgenössischer Philosoph der sprachanalytischen Schule, der Frage nach, wie so etwas wie menschliche Zivilisation überhaupt entstehen kann und er untersucht die gemeinsame Grundstruktur der gesamten gesellschaftlich-institutionellen Realität. Thema des Buches ist also der Entwurf einer sozialen Ontologie, der bei diesem Autor der sprachanalytischen Schule allerdings nichts Metaphysisches anhaftet. Die Thesen, die der Autor vertritt sind im Grunde die, dass die gesamte institutionelle Wirklichkeit des Menschen durch eine einzige logisch-sprachliche Operation geschaffen wird, und zwar durch eine Status-Funktionen-Deklaration (Menschen haben die Fähigkeit Gegenstände oder Personen Funktionen zuzuweisen, die Ausübung der Funktion setzt voraus, dass der Status der Funktion kollektiv anerkannt ist; und nur aufgrund dieses anerkannten Status kann die betreffende Funktion dann ihre Aufgabe erfüllen; Beispiele für Status-Funktionen wären irgendein Privatbesitz oder ein politisches oder berufliches Amt oder z. B. ein anerkannter Geldschein) aus der Verpflichtungen entstehen. Diese Operation hat keine Einschränkungen auf bestimmte Gegenstandsbereiche, kann verschiedentlich auf unterschiedliche Gegenstände angewandt werden, die sich miteinander verzahnen können. So entstehen die komplexen Strukturen menschlicher Zivilisation. Der Autor bedient sich in seinem Buch einer ungewöhnlich klaren Sprache, allerdings unterfüttert er auch seine Theorie mit einer ganzen Anzahl von Fachtermini-Neuschöpfungen, die er allerdings immer ansprechend erklärt. Seine Ausführungen finde ich zum Teil aber etwas zu knapp, so dass für mich doch einige Fragen ungeklärt blieben und mir das ganze Buch nicht wirklich hinreichend ausgearbeitet erschien. Besonders interessant fand ich seine Begründung von Menschenrechten, seine Minimalliste umfasst das Recht auf Leben und Unversehrtheit der Person, das Recht auf Privateigentum, das Recht auf Redefreiheit, das Recht auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, das Recht auf Glaubensfreiheit, das Reiserecht und das Recht auf Privatsphäre. Searle meint nun, das jede Theorie der Menschenrechte auf einer Theorie der menschlichen Natur beruhen müsse, eine Ansicht, die er meiner Meinung nach aber nicht zufriedenstellend in entsprechender Ausführlichkeit entfaltet (was der Autor auch in der Tat selbst eingesteht).
Das Buch ist gut, allerdings eher kein populärwissenschaftliches Werk, sondern ein echtes Fachbuch.
Jürgen Czogalla, 07.06.2012
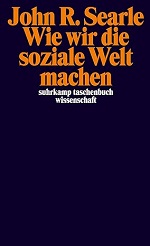
![]()