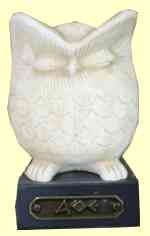
Philosophisch-ethische Rezensionen
(Erscheinungsdatum der rezensierten Bücher: 20. und 21. Jahrhundert)
Miranda Fricker, Folgen epistemischer Ungerechtigkeit
Wenn vorurteilsbehaftete Stereotype, so Fricker, Glaubwürdigkeitsurteile
verzerren, gibt es einen klaren erkenntnisbezogenen Schaden: Informationen werden nicht ernstgenommen, was für den einzelnen
Hörer einen epistemischen Nachteil und eine punktuelle Funktionsstörung der gesamten epistemischen Praxis darstellt. Das
schädigt also unser ganzes Erkenntnisleben. Außerdem stellt die Tatsache, dass die Sprecherin wegen Vorurteilen ihr Wissen
nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen kann, eine schwerwiegende Form der Unfreiheit dar, denn: Die freie Sprechsituation
ist grundlegend für die Autorität des Gemeinwesens, ja sogar für die Vernunft an sich. Dem ungerecht behandelten Sprecher
wird außerdem in seiner Eigenschaft als Wissender Unrecht angetan. Damit wird eine für den menschlichen Wert wesentliche
Eigenschaft verletzt, der so Behandelte erleidet eine intrinsische Ungerechtigkeit. Dadurch wird sein Menschsein im Kern
untergraben. Das epistemische Unrecht trägt außerdem soziale Bedeutung, denn der Betroffen gilt nicht mehr als vollwertiger
Mensch, er wird als Wissender herabgesetzt und als Mensch symbolisch entwürdigt. Auch wenn das Unrecht ansonsten eher
geringfügig sein mag, kann es doch auch dann schon zutiefst demütigend sein. Es handelt sich also auch um eine Form der
epistemischen Beleidigung. Während sich epistemische Vertrauenswürdigkeit durch Kompetenz und Aufrichtigkeit auszeichnet,
werden hier oft diese beiden Komponenten durch Voreingenommenheit infrage gestellt. Der Betroffene wird aufgrund
identitätsbezogener Vorurteile aus der epistemischen Vertrauensgemeinschaft ausgeschlossen. Das ist dann auch nach Fricker
der primäre Schaden. Der sekundäre Schaden wird durch den primären verursacht, ohne dass er direkt zu diesem gehört. Die
praktische Dimension: z.B. vor Gericht oder im Beruf nicht ernstgenommen zu werden (zu Unrecht verurteilt zu werden, bzw.
die eigenen Leistungen werden nicht anerkannt oder gesehen). Die epistemische Dimension: Verlust des Vertrauens in die
eigenen Überzeugungen beim Erleiden von Zeugnisungerechtigkeit. Dadurch fehlen dann die Voraussetzung, die für Wissen nötig
sind. Das kann zu einer Beeinträchtigung der geistigen Entwicklung führen. Bei anhaltender Zeugnisungerechtigkeit wird die
Identitätsbildung gestört und die geistige Persönlichkeit leidet, verursacht durch den Verlust von intellektuellem
Selbstvertrauen. Außerdem schließt Zeugnisungerechtigkeit den Menschen vom vertrauensvollen Gespräch aus, welches aber wichtig
ist, den Geist zu festigen und entscheidende Aspekte der Identität formt. Schließlich kann ein Vorurteil, dass sich gegen
einen Sprecher richtet, eine selbst erfüllende Kraft entwickeln. Wenn etwa Frauen in gewissen Gesellschaften immer so behandelt
werden, als hätte sie kein Talent für Politik, dann werden sie in den meisten Fällen auch kein Talent dafür entwickeln können.