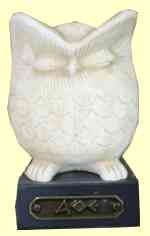
Philosophisch-ethische Rezensionen
(Erscheinungsdatum der rezensierten Bücher: 20. und 21. Jahrhundert)
Dieter Thomä über Jean-François Lyotard
Thomä stellt fest, dass Lyotard die Postmoderne für sich reklamiert
und als Autor der Postmoderne in der Philosophie gilt. Lyotard meldet Zweifel am Projekt der Moderne an, die sich zur
Aufklärung bekennt: Die Menschen aus Unwissenheit, Unterwerfung und Elend zu befreien. Außerdem attackiert er den
Anspruch, Denken und Welt, Sprache und Wirklichkeit, Theorie und Gesellschaft zur Deckung zu bringen. Die Wirklichkeit,
so Thomä, lässt sich nach Lyotards Meinung nicht restlos und verlustfrei erfassen. Er erklärt dem Ganzen den Krieg und
setzt sich für Heterogenität als unüberwindliches Hindernis aller Hegemonie ein. Gut denken, fühlen und handeln bedeutet
für ihn sich der Tyrannei der Ganzheiten zu verweigern. Denn nach Lyotard ist Totalisierung im menschlichen Vorhaben
potentiell totalitär. Er ist sozusagen auch ein Schutzpatron des Undarstellbaren. Eingeschliffene Darstellungsweisen
werden deswegen aufgebrochen, um das Gefühl dafür zu stärken, dass es Undarstellbares gibt. Er möchte außerdem dem
imperialen Vernunftterror trotzen, indem er die Vielfalt und Unübersetzbarkeit der ineinander verschachtelten Sprachspiele
herausstellt. Dieses Lob der Vielfalt nennt Thomä ein einheitliches oder einfältiges Merkmal aller postmodernen Positionen.
Für ihn steckt hinter dem Lob der Vielheit eine Wendung gegen das Eine und Einige, eine dumme, negative Fixierung der
Postmoderne auf die Moderne. Da das Einswerden gemieden wird, darf es dann natürlich laut Thomä auch nicht zur Einigkeit,
Übereinkunft, Gemeinsamkeit und Konsens kommen. Dazu kann es wegen der angenommen Unübersetzbarkeit zwischen Sprachspielen
nicht kommen und dazu darf es nicht kommen, weil es allen frei stehen soll, ihr Ding zu machen. Während Selbstbestätigung
und Bejahung erlaubt sind, wird so Zustimmung verdächtig. Nach dieser Logik ist man zum Lob der Vielfalt verdammt, weil
man andernfalls den Terror der Totalisierung verbreitet. Dazu kann es nach Thomä nur kommen, weil die Postmoderne die
Abgrenzung gegenüber der Vergangenheit wichtiger nimmt als die Offenheit gegenüber der Zukunft. Für Thomä ist dann der
Weg von kleinen Erzählungen zu Filterblasen und Echokammern nicht mehr weit, in dem es sich die Menschen in ihrem kleinen
Silo isoliert einrichten. Dadurch wird auch eine Identitätspolitik in Leben gerufen, die schädlich ist.
31.08.2025.2025